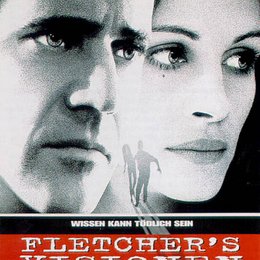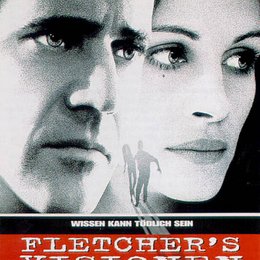Fletcher's Visionen: Flapsig-selbstironischer Paranoia-Thriller mit hochkarätiger Besetzung. Von den "Lethal Weapon"-Machern.
Zum zugkräftigen Triumvirat aus Regisseur Richard Donner, Produzent Joel Silver und Protagonist Mel Gibson, das für die lukrative „
Lethal Weapon„-Trilogie steht, gesellt sich mit „
Pretty Woman“ Julia Roberts (derzeit wieder im Karrierehoch mit „
Die Hochzeit meines besten Freundes„) ein weiblicher Superstar. Die kommerziellen Vorzeichen für den flapsig-selbstironischen Paranoia-Thriller stehen hinsichtlich dieses hochkarätigen Traumteams also denkbar gut.
Gibson mimt den psychisch gestörten New Yorker Taxifahrer Jerry Fletcher, der seine fantastischen Verschwörungstheorien jedem Fahrgast und den fünf Abonnenten seines Newsletters „Conspiracy Theory“ unterbreitet. Der obsessive Jerry, dessen Apartment einem kargen Überlebensbunker - mit Vorhängeschloß am Kühlschrank - gleicht, beobachtet mit der selben peniblen Besessenheit per Fernglas die Justizminsteriums-Anwältin Alice Sutton (Roberts). Er ist unsterblich in sie verliebt, obwohl er sie lediglich von seinen unangemeldeten Unterbrechungen an ihrer Arbeitsstätte kennt und sie einmal vor einem Straßenraub beschützt hat. Sie belächelt schmunzelnd seine Politparanoia und hält ihn für einen harmlosen Verrückten. Doch als er verletzt bei ihr aufkreuzt und von der Folter durch einen ominösen CIA-Psychiater (Patrick Stewart eiskalt: läßt Erinnerungen an die „
Der Marathon-Mann„-Tour-de-Force wach werden) berichtet, wird sie in ein undurchsichtiges und lebensbedrohliches Verschwörungskomplott um inhumane Mentalexperimente (eine Referenz an „
Botschafter der Angst“ kommt nicht von ungefähr), Mord und Größenwahn gezogen.
Das Skript von Brian Helgeland, der bereits im Vorfeld viel Lob für seine James-Ellroy-Adaption von „L.A. Confidental“ einstreichen konnte, wartet mit einem cleveren Potpourri an weit hergeholten und entfernt möglichen Konspirationstheorien auf, die beispielsweise um Machenschaften von Oliver Stone, George Bush, Jerry Garcia, Aristoteles Onassis, der NASA, Coca Cola und Kentucky Fried Chicken kreisen. Diese Ambivalenz ist ein entscheidendes Element, das sich auf die Charaktere überträgt: Abgesehen von Roberts (Identifikations-) Charakter scheint niemand derjenige zu sein, der er vorgibt zu sein. Der Superstar gibt eine sympathische Vorstellung, und ihr Partner Gibson treibt den latenten Irrwitz seines „stahlharten Profis“ Martin Riggs auf die krankhafte Spitze, ohne dabei an Charme einzubüßen. Hinter der Kamera wurde ebenfalls eine hervorragende Crew versammelt. Die ausgefeilten, stilvollen Bildkompositionen lieferte Kameramann John Schwartzmann („The Rock“), dessen Nachtaufnahmen eines glitzernden Manhattans mit Hilfe eines speziellen Films, der Farbe und Schwarzweiß kombiniert, besonders bestechend wirken. Das Produktionsdesign von Paul Sylbert (Oscar für „
Der Himmel soll warten„) liefert mit Jerrys labyrinth-käfigartigem Apartment und den desolaten Kellerräumen eines Sanatoriums die passend Verfolgungswahn durchtränkte optische Kulisse. Für den unauffällig-eindringlichen Score zeichnet Carter Burwell verantwortlich, der bisher die Musik für sämtliche Filme der Coen-Brüder („Fargo“) komponierte. Der dramaturgische Ton des 70-Mio.-Dollar-Projekts schwankt dagegen etwas unentschlossen zwischen unbeschwertem Ulk, düsterer Beklemmung (das Porträt New York Citys zeigt den Big Apple von seiner vermodernden Seite), romantischer Verspieltheit, stahlharter Brutalität und heroischer Action-Momente. Das folgende, mit einer gehörigen Portion Zynismus gewährte, Happy End riecht ein wenig nach Testpublikums-Einfluß und läßt die Möglichkeit für eine Fortsetzung offen. Trotz seiner 135 Minuten bleibt das Genregemisch trotz einiger Schwächen im logischen Ablauf stets unterhaltsam - und die Stars dürften dafür sorgen, daß dieser Blockbuster-Kandidat seiner Favoritenrolle an der Kinokasse gerecht wird. ara.